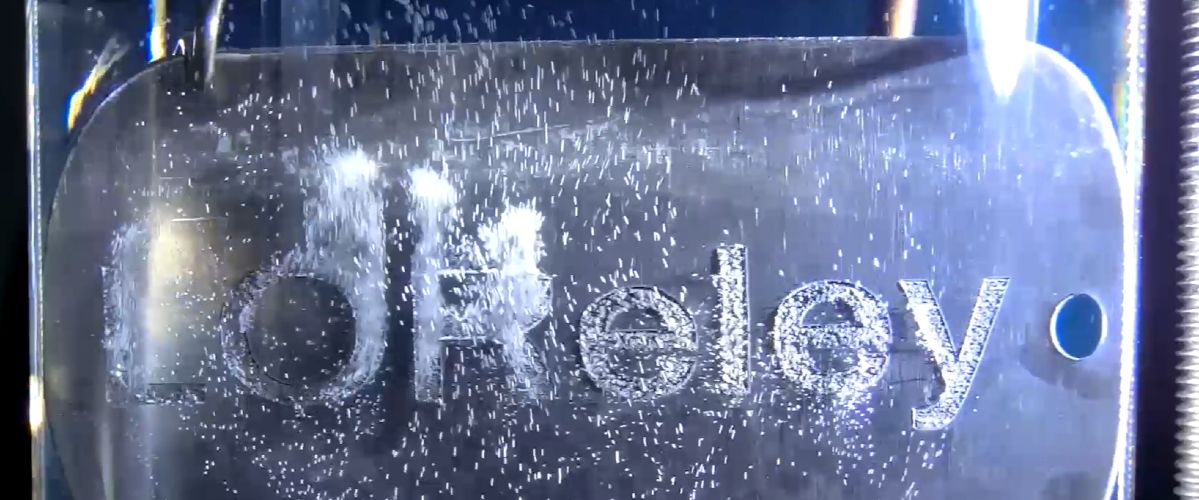Energieforschung
Informationsseite zur Projektförderung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz im Energieforschungsprogramm
Förderung
Das 8. Energieforschungsprogramm zur angewandten Energieforschung
Eine klimaneutrale und sichere Energieversorgung braucht mutige Lösungen, damit sie gelingt. Damit diese Innovationen entstehen und schnell Alltag in Deutschland werden können, fördert das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz die angewandte Energieforschung im Deutschland mit dem „8. Energieforschungsprogramm zur angewandten Energieforschung – Forschungsmissionen für die Energiewende“.